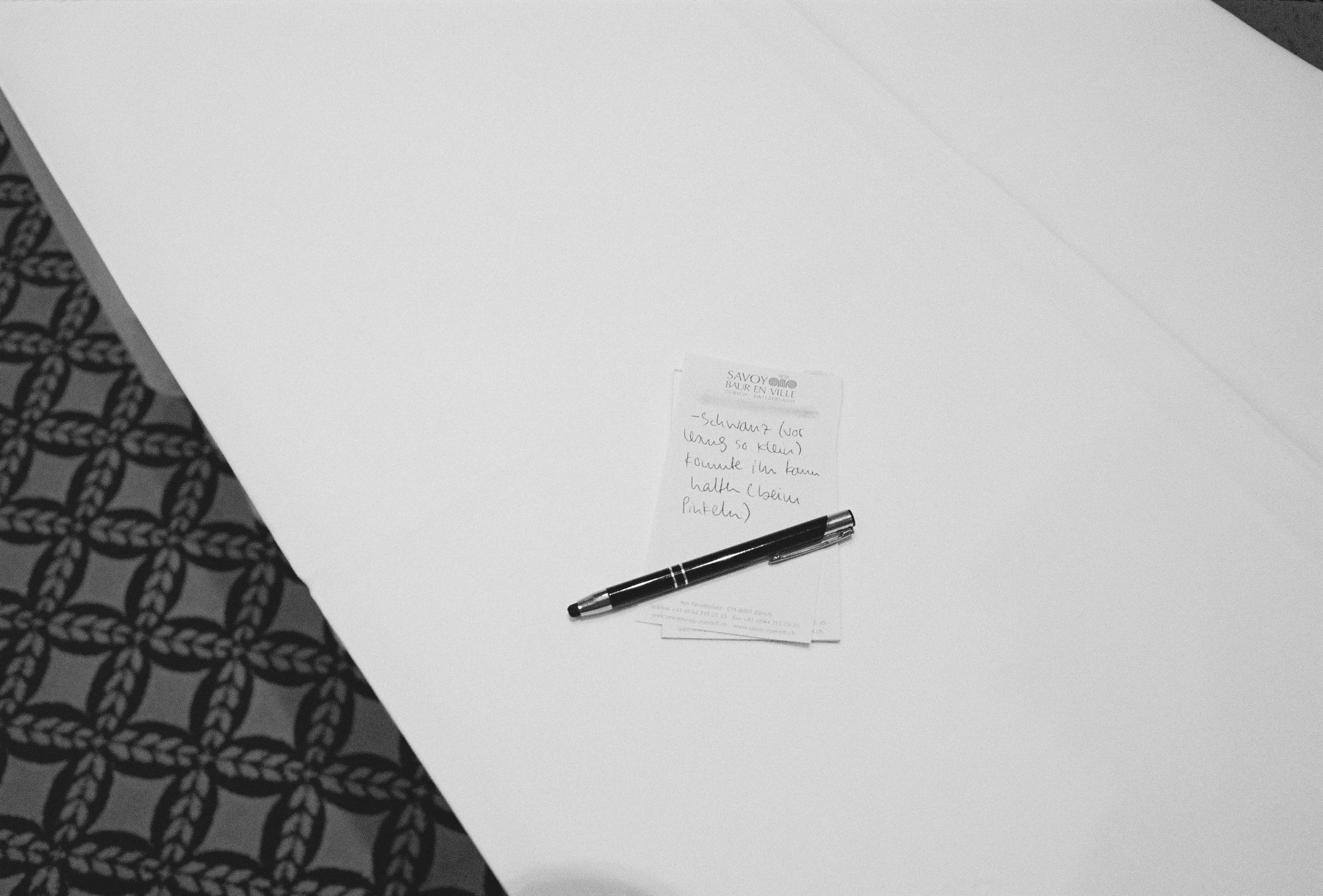HAUS DER HUREN
In einer Zeit, die eine schwere Zeit war und vor einer sehr guten Zeit kam, verbrachten wir viele Abendstunden in einem alten Haus unten am Fluss. Das Haus stand in einer steilen Straße, gar nicht weit von uns, und viele Leute gingen daran vorbei ohne zu wissen, was es war oder sich überhaupt einen Gedanken zu machen, was es sein könnte oder was darin ist. Von außen war es heruntergekommen und manche sagten, es sei hässlich, aber das waren die gleichen, die dann sagten, auf die inneren Werte käme es an. Es sah vielleicht nicht aus wie ein Café auf Treppen bei Nacht, aber es wurde sehr schön älter und das meiste, was heute gebaut wurde, sah nur schön aus, solange es neu war, nicht, wenn es älter wurde. Es konnte nicht alt werden, weil es nicht schön war und das Haus war schön und wir mochten es mit jedem Tag mehr und manchmal, wenn wir in guten Zeiten da gewesen waren und es mochten, konnten wir uns nicht vorstellen, dass die Zeiten je wieder schlecht werden konnten, wenn sie einmal so gut waren und umgekehrt. Es schien immer unmöglich, dass es sich jemals wieder änderte. Für viele war das Haus also ein ganz normales altes Haus mit vielen geschlossenen Fenstern und zwei Laternen dran, die an den Wänden hingen und auf die späten Straßen schienen. Wenn Leute wussten, was es war und man sagte, dass man da gewesen ist, kamen die Leute näher und senkten ihre Stimmen und erzählten vorsichtig, wie es früher dort war und ob man wisse, wo man da gewesen wäre. Sie erzählten es immer mit einem Zwinkern und so, als ob beim Reden etwas davon kaputt gehen könnte. Die Leute erzählten sich viele Geschichten, aber nie eine, die so war wie es war. Denn das Haus war gar kein Puff, sondern eine Bar, in die man ging, wenn es sehr spät war und man in ein Restaurant gegangen ist und in eine andere Bar und dann in einen Club und immer noch niemanden abbekommen hatte. Man konnte auch sein eigenes Mädchen mitbringen und daran arbeiten, dass die Zeit wieder besser wurde oder eben schlechter. Alle Männer enden früher oder später an Theken. In guten und in schlechten Zeiten. Mit oder ohne Frauen, aber Männer ohne Frauen waren meistens unerträglich. Sie interessierte dann außer Frauen nur eins, nämlich nichts. Nicht mal schnelle Autos und wenn fuhren sie die ja nur wegen den Frauen. Sie ließen die Abende so lange Nächte werden, bis daraus wieder Tage wurden, mehr nicht. Trotzdem war es sehr schön wieder Menschen an Tischen sitzen zu sehen oder an Theken stehen, die sich unterhalten und die etwas hatten, über das sie sich unterhalten konnten. Hinter der Theke stand Paulo, aber alle nannten ihn nur wie den Schriftsteller Coelho, wir riefen Paulo Coelho, bring uns doch bitte noch zwei. Er war ein wunderbar freundlicher alter Mann, der sich von Haferflocken ernährte und ein sorgfältiges Leben führte, das sah man an seiner Haut und wie er redete und sich bewegte und nie hätte man gedacht, das er sowas machen konnte oder auch nur irgendwas damit zu hatte. Aber die vielen Nächte und die wenigen Tage machten […]