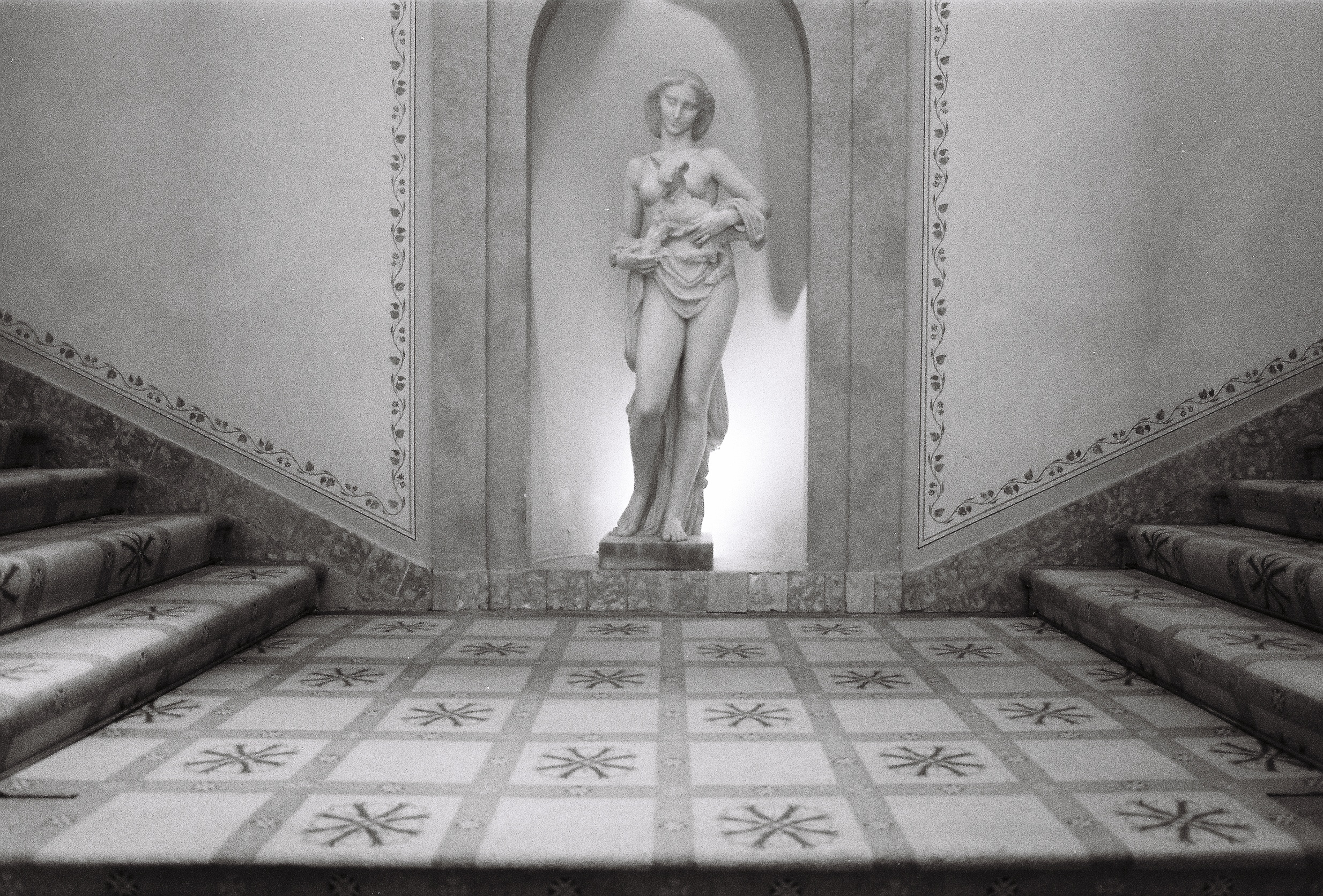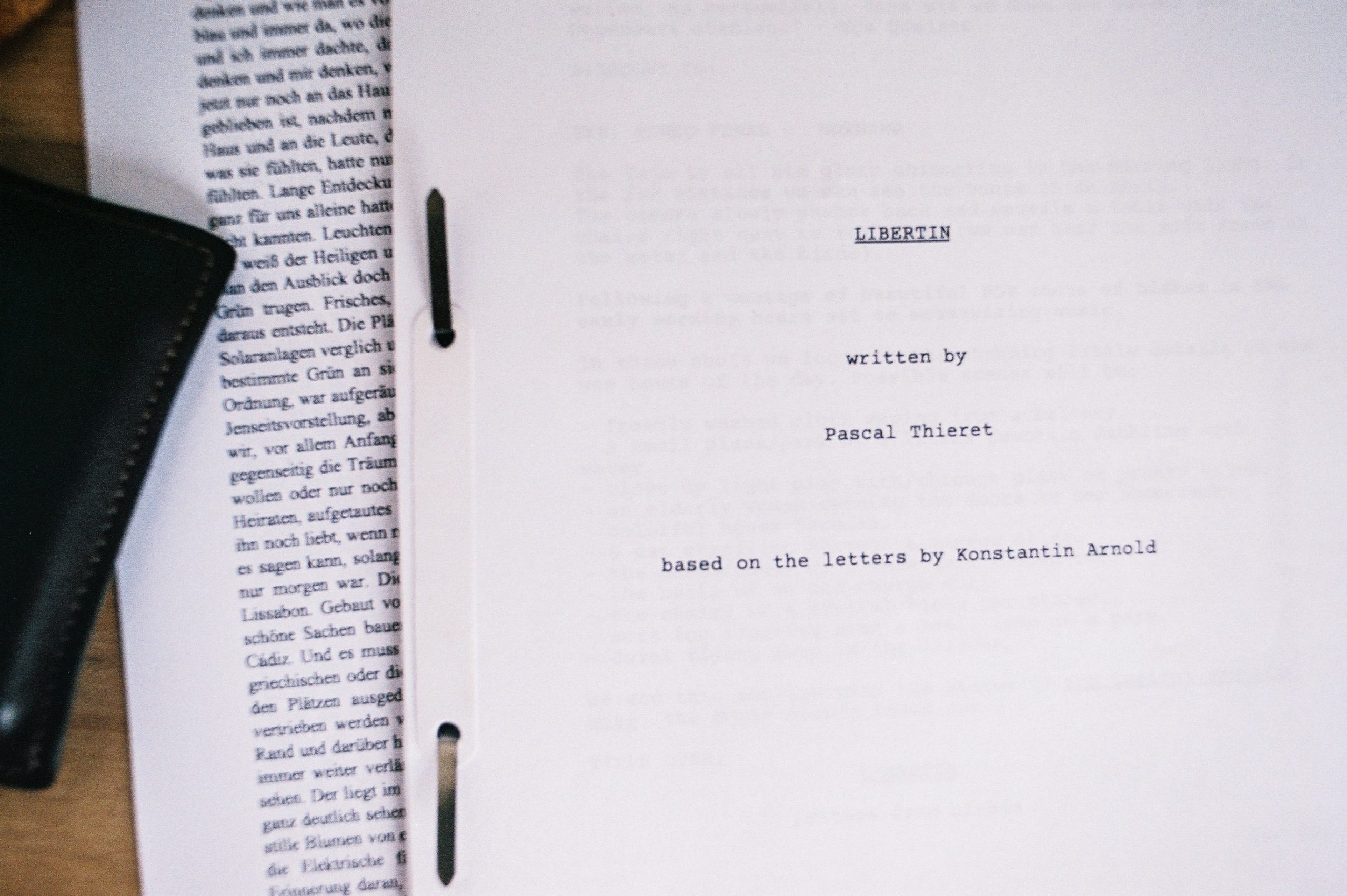FEIERABEND
Oliven. Gottesfrüchte. Fruchtgewordene Antike mit Kern. Denkmäler der Sonne und des Südens, so wie der Wein, aber zu dem kommen wir später. Man kann nicht über die Olivenernte schreiben, ohne über den Wein zu schreiben. Die Weinernte ist vorher, die Keller sind voll davon. Wein ist der Treibstoff für die Ernte und ihre Helfer. Aber erst mal zu den Oliven. Olivenbäume können tausend Jahre alt werden, einfach so, nicht alle, aber einige, der älteste steht auf Kreta, zwischen 3000 und 5000 Jahre alt. Moses hat seine Gebote unter so einem brennenden Ölbaum gefunden. Oder auch nicht, aber Dieter Bohlen hat auf Malle ein paar davon im Garten. Es gibt zwei Kerngebiete im Hirnstamm, die wie Oliven heißen. Nach dem die Arche tagelang unterwegs war, sendet Noah seine Taube aus, die mit einem Olivenzweig im Schnabel wiederkehrt. Ein Lebenszeichen. Bei Picasso stehen sie für den Frieden. Sicher ist, wo Oliven wachsen, kann man gut Leben, die Menschen werden älter, das zeigen Studien. Sie sind schön anzusehen und gesund, eine natürliche Lebenserhaltungsmaßnahme, denn Antioxidantien konservieren den Körper von innen. Heilkraft und Genuss. Geht doch. Im Süden Europas geht keine Mahlzeit ohne die Steinfrucht über die Tische. In Grün und Dunkelbraun und Braun, mit oder ohne Knoblauch, draußen, im freien, auf rotweißkarierten Tischdecken. Oliven zu ernten ist eine Wahlfahrt für Fernwehromantiker. Der Olivenbaum steht überall wo’s schön ist. Am liebsten ums Mittelmeer und auf Kreta, auf den Höhen Italiens, in der Hitze Andalusiens und im wilden Norden Portugals. Dort wollen wir hin. Ich bin schon seit einem Vormittag dran, alle Notizen zu entschlüsseln, die ich mir eine Woche lang beim Olivenernten und Rotweintrinken gemacht habe. Tiefer kann man gar nicht in ein Land eintauchen, als auf dem Land. Da ist noch ein Portugal zuhause, das woanders längst verschwunden ist. Die Entfernung zu diesem Ort lässt sich besser in Jahrhunderten ausdrücken, als in Kilometern. Zeitreisen ist möglich. Man kann aber nicht einfach so aufs Land fahren. Nicht von Lissabon aus. Man braucht etwas Vorbereitung, um sich langsam auf das Landleben und die Zeitverschiebung vorzubereiten. Eine Art Basis Camp, wie man es von einer Everest Expedition kennt. Meins war bei der Familie Delgado. Sie wohnen in einem Dorf bei Fatima, Portugals Pilgerstadt. Eine Zugstunde nördlich von Lissabon. Von hier aus, sollten wir am nächsten Morgen in den Norden des Südens aufbrechen, zum Heimatort von Senhor Delgado, bis fast an die Grenze zu Spanien. Senhor Delgado ist ein einfacher, herzlicher Mann mit großen Gesten. Eine ehrliche Haut mit Dreck unter den Nägeln und den nötigen Kraftsaudrücken. Er hat diesen Bauch, der ihm steht und den man hat, wenn man ihn sich mit Selbstgemachtem verdient hat. Seine Hände sind klein, aber sein Finger vom Arbeiten über die Größe seiner Hände hinausgeschwollen. Er weiß alles über Oliven und über Wein und er weiß, wie die Erde schmeckt aus denen sie kommen, weil dort seine Ahnen liegen und selbst zu Erde geworden sind. Sie haben selbst Olivenöl und Wein gemacht und sie haben ihr Mittag im Freien gegessen und sind alt und stark geworden. Er sagt gerne, dass das Leben so ist oder dass das Leben schön ist oder hart und wenn er nichts zu sagen hat, sagt er jaja, so ist das Leben oder das Landleben ist eben so. Am liebsten sagt er Ach, Mein Land, aber auf Portugiesisch klingt das besser: A minha Terra, meine Erde. Senhora Delgado ist eine wundervolle […]