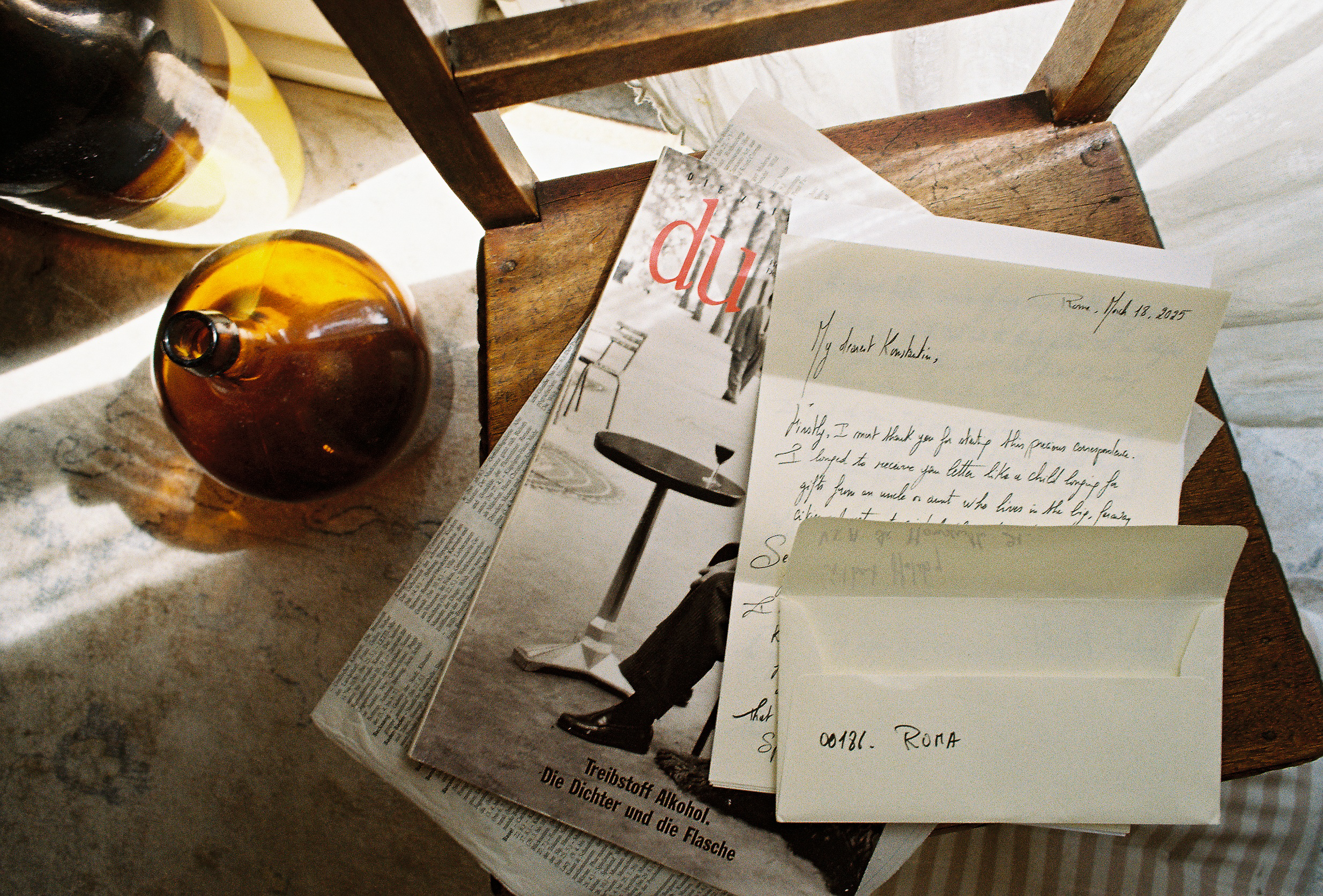AVANCEN
Gestern habe ich versucht Schnaps zu trinken, wie ein Mann, der viel Raucht und versucht an sich zu halten. Es ist besser an sich zu halten, wenn das Glück kaum auszuhalten ist, weil es dann gut tut, wenn man es nicht tut und einen Augenblick so tut wie ein Mann, der nicht über Gefühle sprechen kann und endlich Zeit hat, Platon zu lesen. Nackt und in doppelter Übersetzung. Sie auf Portugiesisch, ich auf Deutsch, in einem schönen, weißen Goldeinband, der leider eine Weile im Keller meines Lebens geschimmelt hat. Die Deutsche Übersetzung ist an manchen Stellen besser, die Portugiesische an einer, die vielleicht die beste von allen ist. Die haben wir dann auch beide unterstrichen, ist aber schwer zu beschreiben, weil Platon das schon beschrieben hat und sowieso alles, was ich gerade schreibe, nicht so schön ist, wie es ist. Ich wohne am Meer, mit der Frau, die ich liebe. Nur das Unglück braucht länger, um sich auszudrücken. Es ist ein kleines, einfaches Haus mit Garten, nicht weit vom Strand, in dem man Ferien im Leben machen kann. Morgens frühstücken wir im Freien, Mittags gehen wir zum Markt oder Schwimmen oder beides, abends ein bisschen Espumante. Draußen ist Teil des Drin. Im Garten steht eine große Pinie, die im Abendlicht Feuer fängt, wenn der Rest vom Himmel brennt. Darunter liegt ein Hund, der manchmal kommt, aber nicht unserer ist. Vielleicht benutzen wir den mal für einen Herbstspaziergang, nachdem wir den vormittag lang im Bett gelesen haben. Das Schlafzimmer ist auch das Arbeitszimmer. Die Stadt keine zwanzig Minuten weit weg. Ich fahre wenn meist montags mit dem Zug, weil das ein Scheißtag ist und Scheißtage gute Tage sind, um die Post zu holen, Notizbücher zu kaufen, Zeitung, Kaffee, Kippen und Wein. Ich mache dann Listen, wie man die Dinge am besten anstellt, zieh mich schick an, bin wirklich in der Stadt, vollkommen vorbereitet und angezogen, wie Leute vom Land. Sie schmiert mir Brot und sagt, ich soll anrufen, wenn ich angekommen bin. Abends steht sie dann schon am Tor und winkt und ich bin froh wieder hier zu sein. Lissabon ist mittlerweile zu voller Menschen, die Karriere machen oder wollen, dass das die Stadt für sie übernimmt, mit vielen hübschen Geschäften, und Verkehr, der am Abend hier kaum vom Rauschen des Meeres zu unterscheiden ist. Alle Straßen führen zum Meer und enden in Gemälden vom Meer, die von Bäumen gesäumt sind. Dazwischen stehen Villen, die man durch alte Mauern in ihren Gärten beobachten kann. Die Idylle zwingt alle Einzelheiten in ihren Rahmen. Der Strand ist nie weit. Er ist keine Autofahrt und auch keine Parkplatzsuche oder Zugfahrt weit weg. Man muss nicht mal einen Schlüssel mitnehmen und sich nach dem Platon lesen nur daran erinnern, dass man am Strand ist, eine Erinnerung weit weg. Am Anfang wohnt man natürlich sehr heftig, hat Geschmack, Aufmerksamkeit und Zeit. Dann gewöhnt man sich normalerweise das Wohnen ab und macht mit seinem Leben weiter und lässt es die Möbel und Gegenstände übernehmen, wenn man welche hat. Sagen jedenfalls die Leute aus der Stadt, die immer was für sich wollen und Kerzen als was romantisches bezeichnen. Wir sagen das nicht, weil das Wohnzimmer auch die Küche ist. Ist nur ein kleines Haus, ist ja auch ein kleine Küche, mit einem Kühlschrank, der keine großen Einkäufe zulässt. Die Tägliche Häuslichkeit durch Flitterwochen ersetzt. In einem kleinen Dorf, nicht weit von Cascais, aber anders, grün mit Quintas und weiten Flächen, auf denen nichts ist und Bäume stehen und Sachen, die nicht gebaut wurden. Die Gegend kommt ganz ohne Tankstellen aus. Wenn die Sonne am Abend weg ist, zieht Nebel auf vom Meer und kommt in unsere Straße. Er hüllt alles ein, die Straße, uns und das Haus mit den Straßenlaternen, die davor wie stille Planeten im Nebel stehen. Man hat dann das Gefühl, die einzigen zwei Menschen auf der Welt zu sein, die noch Wein brauchen, wenn da draußen, in den weiten unserer Milchstraße, kaum noch irgendwas offen hat. Anstatt in die nächste Bar geht man ganz nah am Wasser lang oder zwischen den Häusern. Man geht bis die Straßen einen doch wieder zu einem zurück führen, wenn man sich in ihnen verliert, die Welt abhängt und das Gefühl hat, ganz und gar auf ihr zu sein. Nicht weit von hier gibt es eine kleine Bar mit Balkon, in die man schon gehen kann, wenns nicht ohne geht, aber meistens geht es ohne und wir kochen und trinken und gehen dann. Samstags fahren wir zum Tanzen in die Stadt. Treffen Leute, lassen uns verwickeln, sehen meine Ex oder ihren oder wie uns die Leute sehen. Man vergisst sonst, wer man ist und streitet, betrunken, auf der Heimfahrt, ohne Versicherung. Wir haben uns aber vorgenommen, nicht mehr beim betrunken Fahren, ohne Versicherung, zu streiten […]