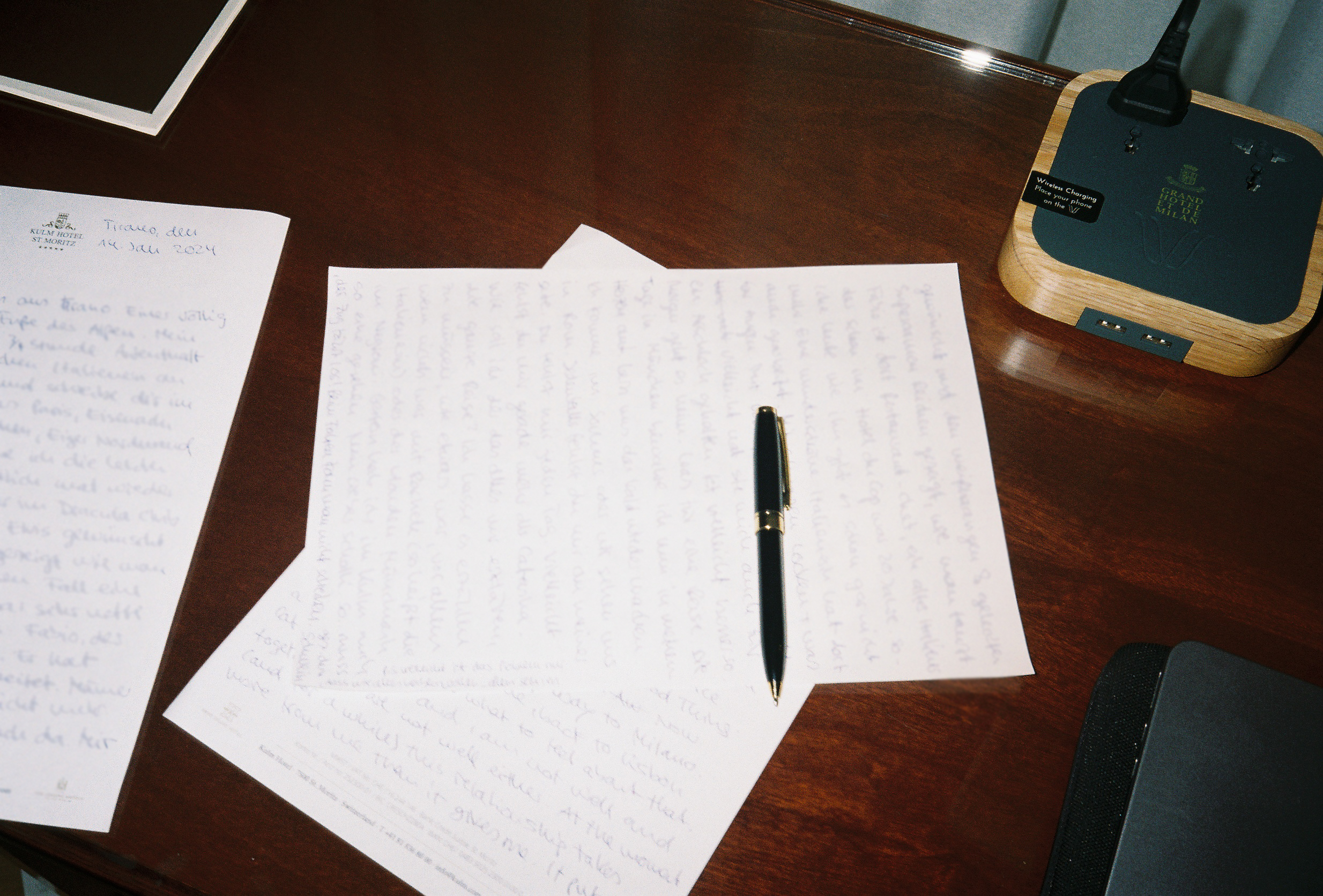TAGE AUSSERHALB DER ZEIT
Diese Geschichte beginnt an einer Bahnstation. Ein Zug stöhnt und ein Zugschreier schreit. Rauch steigt auf, der die ersten Zeilen verhüllt und die Anzeige: Von Venedig nach Wien mit dem Zug. Allein wie das klingt. Besser klingt das nur, wenn man Vienna und Venezia sagt, ohne Zug, weil das alliterarischer ist. Denn die Realität dieser Vorstellung ist ein völlig überfüllter Bahnhof Venezia Mestre, 35 Grad und ein Zug der ÖBB, der seit einer Stunde hier sein soll. Mal am Gleis vier, mal dort, mal gar nicht mehr, je nachdem wo die meisten aufgeregten Wiener in dreiviertellangen Hosen und Kurzarmhemden stehen. Sie fragen, ob ich nicht auch nach Wien müsste und warum ich dann noch so ruhig aussehe und so dick angezogen wäre (Mantel, Anzug, Zuschicket in der Brusttasche) und warum der Zug schon wieder nicht auf der Abfahrttafel angeschrieben steht. Ich antworte, dass wir eben noch nicht in Wien sind und 35 Grad zwar heiß, aber noch kein Grund für dreiviertellange Hosen. Sie fragen, was mich überhaupt nach Wien führt, na Wien und ein bisschen der Weg dorthin, was man denn sonst für einen Grund brauche? Er sah mich mit misstrauischen Nachbarschaftsaugen an und versuchte das zu entschlüsseln, aber er hatte nichts von jener Begeisterung, die Abfahrttafeln, mit Zeiten und Zügen, die über Grenzen gehen, in einem auslösen können. Für mich lesen die sich wie Depeschen zwischen den Hauptstädten: Budapest, London, Ljubljana, Prag, Berlin, ein Gefühl am Gleis. Ich warte sehr gerne. Das konnte der Wiener einfach nicht verstehen und ich verstand das einfach nicht, aber uns rettet die Durchsage, der Zug wäre in einer Stunde hier. Hätten wir doch besser ein Flugzeug genommen, schimpfte er. Wenigstens etwas, in dem wir uns einig waren. Für ihn war das jetzt gerade genug, um noch eine Stunde wütend am Gleis zu stehen bis der Zug endlich dran steht. Ich fuhr nach Venedig, rauchte, sah mir den Canal Grand an und fuhr wieder zurück. Eine zweistundenlange Stunde später kam er auch. Man hat nun schon einen ganzen Vormittag am Bahnsteig verbracht und muss nun, für den gefühlten Rest seines Lebens, sitzen. Der Zug von Venedig nach Wien ist kein Nachtzug. Erst ist genau so lang, aber er fährt am Tag, ohne die Liegeplätze. Er ist überfüllt mit wütenden Menschen, die gewartet haben, ohne Venedig zu sehen, es ist heiß, das Internet kaputt, die Getränke warm und mein Platz unter der Anzeige, die mir unentwegt vor Augen führt, dass es bis Wien noch neun Stunden sind. Ein Wiener kommt und bringt sein Gepäck in Sicherheit, weil ihm ungeheuer ist, dass ich drei Hemdknöpfe offen habe, vorher Mantel trug und nun unter seinen Dingen sitze. So wird man natürlich nervös. Ich weiß nicht, wies ihnen geht. Züge unterteilen mein Leben in Kapitel. Sie unterteilen Tage und Zeiten und fahren sie weit voneinander weg. Sie trennen die bei Parmesanbauern, von denen in Genua und San Remo und nun hoffentlich die außerhalb der Zeit in der Toskana. Keine Ahnung, ob die eine gute Idee waren. Diese Geschichte fängt deshalb da an, wo eine andere aufhört, die noch nicht ganz fertig ist. Die Wiener, die Anzeige, das wirft alles Fragen auf. Mein Herz schlägt, schreit raus! Der Schaffner beruhigt mich, sagt, ich könne hier nicht raus, mein Kopf versuchts auch. Er verlangt nach guten Gründen, um jetzt hier einfach auszusteigen und alles hinzuwerfen: Diese Zuggeschichte, das Honorar, meine Miete. Bis kurz vor Udine halte ich das aus, schiebs auf den Schlafmangel, den Wein, die generelle Melancholie eines jeden Abschieds, Reisegerede, die Schwebe, bevor etwas endet und was neues beginnt. Ich redete mir ein, dass es feige wäre, jetzt zur ihr zu fahren, nur weil man sie vermisst und das Vermissen, irgendwann sicher schon vergeht. Nächster Halt war Portogruaro, dann Udine, die letzte Stadt vor der Grenze. Villach, Klagenfurt, Wien, kein Weg in die Zeit zurück. Das Internet immer noch kaputt und nur ein Buch von Faulkner dabei, Udine kommt näher. Man will einfach nicht, dass die Geschichte hier jetzt vorbei ist, und eine andere anfängt, denkt, denkt nach, hört auf, nach zu denken, und auf sein Herz, schnappt sein Zeug, zeigt dem einen Wiener den Vogel, steigt aus, steht da, irgendwo, sieht seinen Zug tatsächlich weiter nach Wien fahren, lacht, bis einem das Lachen vergeht, weil die Dicke am Schalter sagt, dass es heute kein Ticket mehr gibt […]