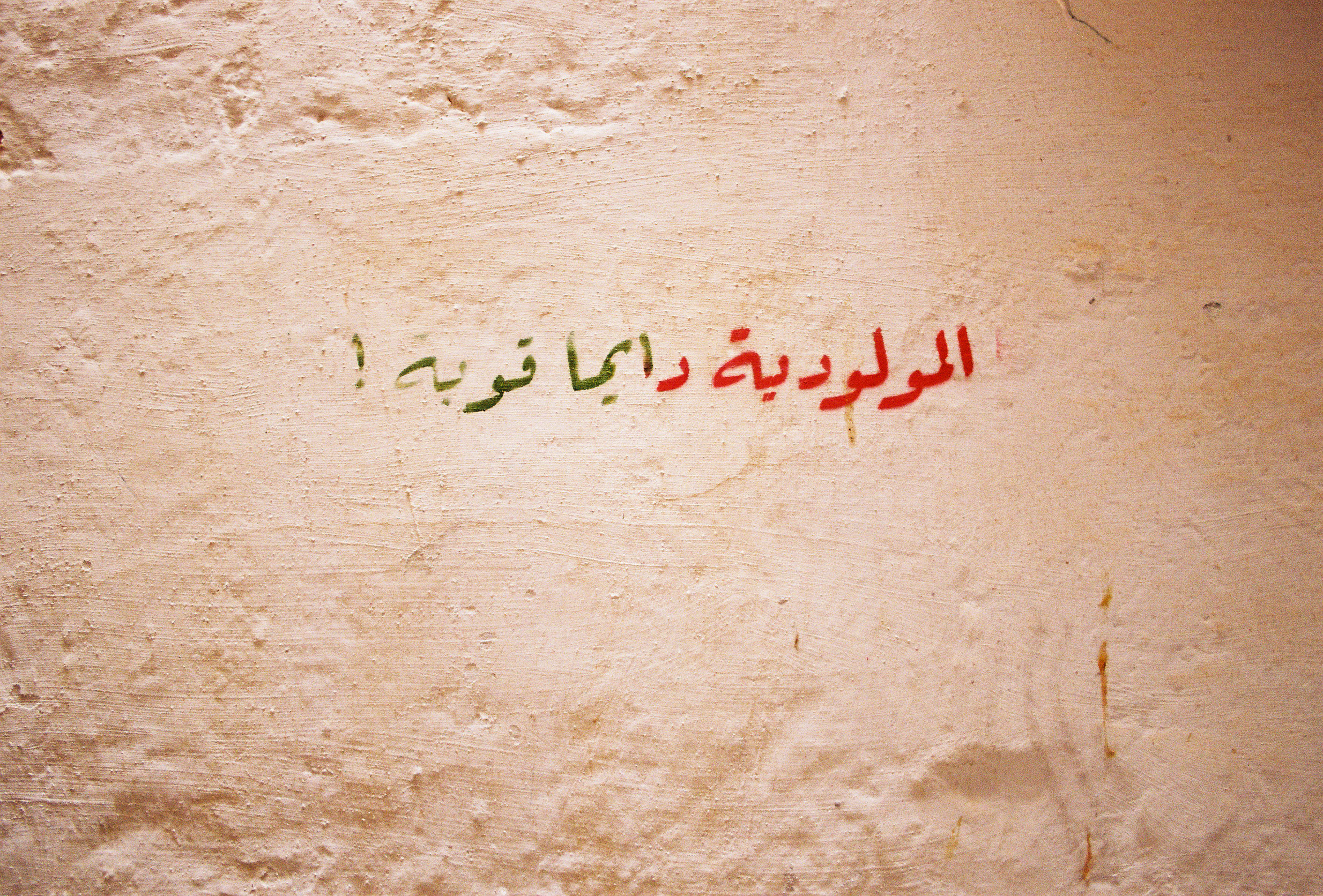MACHO
Es ist jetzt lange hell und dunkel unter den Bäumen in den Straßen der Stadt. Sanfte Sommerluft kräuselt die Juninächte. Alles grün oder so, dass es einem, nach einer langen, kahlen Zeit wieder auffällt, bis auch dieser Sommer einfach nur noch selbstverständlich ist, und heiß; drei mal Duschen und zwei Mal Scheißen am Tag. Gerade ist er noch die Erinnerung an den Winter und den Sommer davor und Schaumwein nach langen Tagen, der einem den Mund wäscht. Stimmung, die nie lange hält, so wie Sommerregen und Schatten in Wohnungen, die man beschreibt. An den kühlen Morgen heißer Tage, mit dem Geruch von Regen, fühlt es sich ausnahmsweise richtig an, was man tut. Die Welt hat sich beruhigt und nichts getan über Nacht, was zeigt wie schön doch Nichts ist. Lissabon erholt sich von vier bis acht in der Früh, versichert sich seiner Wahrheit und vergisst alles, was es vorher getan hat. Aufwachen, schwitzen, Blick auf die Stadt. Batikhimmel, Greccowolken, die sich aber verziehen. Zu den Bergen über die Ebene hin zum Dunst. Alle Fenster sperrangelweit offen. Mit einer Zutraulichkeit zur Straße hin, wie man sie sonst nur aus Städten wie Neapel kennt. Man will dann nicht mehr von diesen Tagen als Morgens noch ein bisschen Zeit, Arbeiten und Abends ein bisschen von dem Wein, der einem das Arbeiten am nächsten Tag wieder gestattet. Manchmal hat man nach zwei Flaschen immer noch keine Lösungen gefunden, aber dann gibt es auch nichts zu schreiben, außer das der Abend kam, spät im Sommer, soweit südlich, und man die Dinge von heute Morgen vielleicht noch zu ende denkt. Man ist dann einen Augenblick so glücklich, dass einem die Wandmalereien in den Metros auffallen. Sie sind immer da, aber meistens nicht. Die Lichter und Leute leuchten unten in den Cafés, ganz ohne Angst, und man will alle Leute, überall, gleichzeitig sein. Außer uns. Denn Streit legt sich mal wieder wie ein grauer Schleier über die Tage und dämpfte jede Freude. Selbst in den Augenblicken, in denen man vergisst. Der Regen klopft mit weichen Fingern an die Fenster, als wolle er herein. Nass und grau wehen die Fäden im Wind vor den gelben Lichthöfen der Laternen. Trostlos und ohne Form, trauriger als Weinen. Nach einer Weile will man trotzdem wissen, was ihre Arbeit macht und was sie von diesen oder jenen Plänen hält. Man will allein gelassen werden, aber nicht allein sein. Ich kann erst richtig allein sein, seitdem ihr mit ihr bin. Früher ging das nicht, da rief ich immer irgendeine Frau an oder einen irgendeinen Mann an, sobald man allein war. Allein sein oder allein zusammen sein ist dann nicht schlimmer oder besser als alles anderes auch. Am liebsten würde ich einer dieser schicken jungen Männer in blauen Anzügen sein, die nach der Arbeit minimalistische Rucksäcke tragen und elektrische Zigaretten rauchen, wer weiß wie viele. Sie haben Frauen, die ich auch haben will und führen Leben, die ich nicht führen kann, da wo Lissabon ist, wie Madrid. Sie sitzen nach der Arbeit auf ein Bier zusammen, oder fünf, kann also spät werden, wenn sie niemandem haben, dem sie das erklären müssten. Manchmal versuche ich das nachzumachen und arbeite in einem Café, da wo Lissabon noch ist wie es nie war. Vor allem, wenns zu Hause heiß ist und man mit einer Schnellfeuerwaffe in das Gebrüll seiner Nachbarn und das Gebell der Hunde schießen will. Morgens der Rasenmäher im Park, abends Techno, dazwischen Streiten, weiß nicht, was schlimmer ist. Wenn man ihnen das sagt, sagen sie ich soll zurück in mein Heimatland, vai a tua terra caralho, sagen sie dann. Ich hielt Arbeiten in Cafés zwar für ein Klischee, wollte mich von diesem Vorurteil aber nicht davon abhalten lassen. In der Confeitaria kann man gut arbeiten, weil die oben absperren und mich in Ruhe lassen, ohne das schlechte Gewissen, das sie daheim in mir auslöst. Außerdem kommen keine Hunde rein, die Weiber an der Leine zerren und es gibt AC. Man versucht sich unter fremden Blicken aufrecht zu halten. Manchmal kommen schöne Frauen rein, aber man kann sie vergessen, wie damals, als eine Frau noch nicht alle Frauen war und musste nicht mehr wissen, wie Spucke riecht, die auf ihrer Haut trocknet. Außerdem alte Leute und Paare, die alt sind und andere Partner vorher hatten. Sie sitzen nachkriegsschweigend vor sich und ihren Kuchen und haben keine Kraft mehr, sich zu erklären. Sie wollen keine Schmerzen und jemanden mit dem man Kreuzfahrten machen kann. Meistens redetet sie und er sagt nichts, ohne zu denken, was sie dann fühlt. Er gähnt uns sie fragt, ob sie denn nicht aufregend genug ist? Er sitzt da und starrt sie an, wartet auf eine Regung, fragt, ob sie schon nach der Rechnung gefragt und wenn ja, solle sie doch lieber vorgehen oder eben nicht. Sie sprechen über organisatorisches, das man auch nicht organisieren muss und sie fragt, obs ihm denn gefällt, hier, in Lissabon. Natürlich gefällts ihm, sagt er. Wieso solls ihm denn auch nicht gefallen (verflucht). Gut, wie lange sie dann nun schon hier sind und obs ihm geschmeckt hat und er noch was will oder sie besser gehen sollen? Vielleicht soll sie doch besser mal vorgehen, vielleicht aber auch nicht. Ach, sie hätten ja Zeit, die vergeht und seit einiger Zeit, hätte sie starke Magenprobleme und könne nichts mehr trinken. Jedenfalls keinen Wein mehr, nur manchmal nippt sie an seinem Schnaps. Er zahlt und sie hält ihm die Jacke, und er humpelt an ihrer Seite in die Ferne davon. Nach all dem und nachdem man all das geschrieben hat, obwohl man was ganz anderes schreiben und die dazwischen kamen, macht man sich auf den Heimweg und kann sich dann einen Heimweg lang wie ein ganz normaler Mensch fühlen, der gearbeitet hat, während der Rest schon hoffnungsvoll aus den Häusern kommt, weil der Tag, den man sich verdient und bis zur Neige auskostet, sein Versprechen auf Zeit bis zum Abend gehalten hat. Lissabons große Stunde. Oben auf den Hügeln hell, unten in den Tälern Nacht. Zumindest unter den Bäumen in den neuen Straßen der Stadt. Abgeschlossenheit, Muse. Was will man mehr? Irgendwo ein Buch lesen? Einen Moment ohne Denken, die Bewegung der Dinge vielleicht? Ein bisschen Zäsur? Überstandene Katastrophen? Und hat jemand den Wind gesehen? Die Abende sind lang und die Nächte warm und so sind die Leute dann auch. Mit frisch gewaschenen Sommersachen durch die der Fischrauch weht. Ein Kommen und Gehen, einen Sehnen. Traumwandeln in der Stadt. Eine mit Problemen jonglierende Atmosphäre. Als wäre das Leben leicht. Es ist schön, nicht leicht, sonst wäre es nicht so schön, denn man riecht den Fischrauch irgendwann bis in die Träume, die man von Sommerkleidern im Vorbeigehen hat. Ein unstillbarer Durst ist in den Leuten, ein Loch aus Musik und der Wunsch sich zu vergessen, zu befruchten, zu ertrinken. Santos ist nun schon ein paar Wochen her, aber die Kinder rennen doch noch, Erwachsene hauen sich weg. Schön mit den Familien im Süden, weil die Eltern bis in die Puppen draußen bleiben und die Zeit rumbringen, dürfen die Kinder das auch. Alle Lachen, niemand muss heim. So lernt man von klein auf die Kunst am Geselligsein und seine Zeit damit zu verbringen, sie zu verbringen, damit sie vergeht. Man tötet im Sommer im Süden die Nacht, denn drinnen wartet die Hitze und jemand mit dem man schlafen muss. Man kommt eigentlich nur zum Schlafen, wenn man todmüde ist oder ein bisschen betrunken. Im Süden kommt das in den besten Familien vor, aber wenn meine Freundin nicht mehr meine Freundin wäre, ist meine Nicht auch ganz schnell nicht mehr meine Nichte und meine Familie nicht mehr die Familie und man steht alleine da und kann nicht mehr stundenlang zusammen Sardinen essen, weil es einem was zu tun gibt und man nicht einfach nur essen kann und trinkt, genauso wie mit Caracois. So wollte ich eigentlich anfangen und mit dieser Stimmung fertig werden bevor die Hitze kommt und mir die Zeilen zerschlägt und Senhor Alfredo und alle, die Lissabon sind, Urlaub von Lissabon machen und zurück zur der Erde gehen, aus der sie kommen, wie man in Portugal sagt. Ich wollte von all den schönen Orten erzählen, an denen wir tanzten, nachdem ich im Jahr zu vor ganz alleine da war und Pfirsiche aß und Menschen beobachtete, vor allem Ricardo, den Kellner, der solche Feste braucht, um endlich ein Mädchen kennenzulernen. Es sollte erst langweilig werden und dann richtig schön. Einzigartig beim Schreiben und nicht wie bei anderen Dingen. Menschen beobachten ist, abgesehen von Krieg, die älteste Belustigung der Welt. Aber seitdem die Hitze da ist, heiß und hell, kann man nur noch ans Meer oder bleibt drinnen sitzen, weil draußen alles so heiß und hell ist, das einem schwarz wird. Man wird lethargisch, wodurch das eine lethargische Geschichte werden kann, obwohl ich alles, wirklich alles versucht habe, das zu vermeiden […]