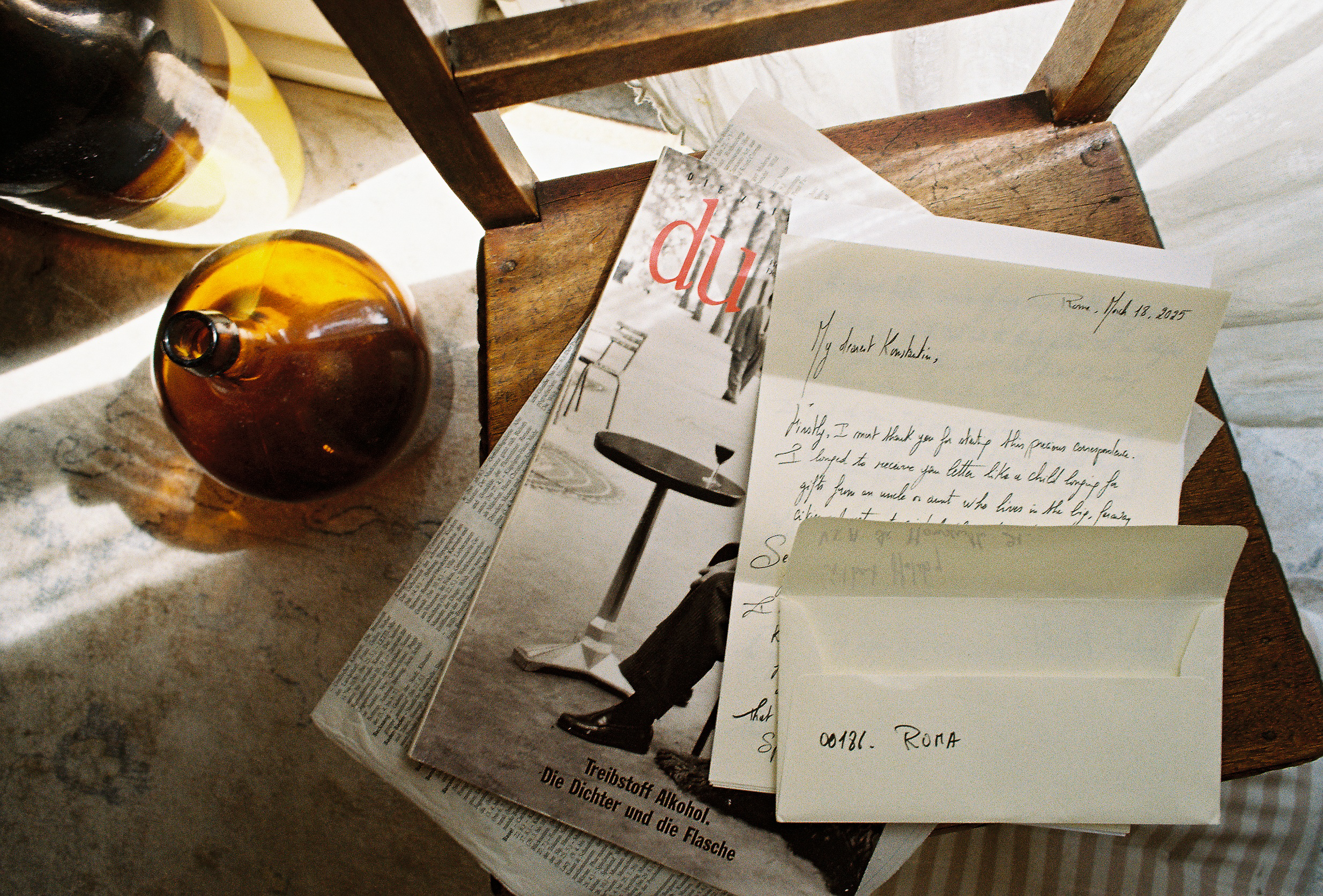IM REIDS
Für manche ist Madeira nur ein Drink, ein Ort, an den man dann mit 60 mal möchte. Eine Insel auf der Welt, irgendwo im Meer und dann links, wenn man lange genug Richtung Äquator gefahren ist. Voll netter Engländer, die nicht nur Saufen möchten und gerne lovley sagen, ein Vorteil also, mehr nicht. Für die, die schon mal da waren, ist es die Erkenntnis, dass das Paradies doch auf Erden ist. Die Insel ist ein Berg im Meer, vulkanausbruchgeschaffen, ein Garten Eden mit Kolonialbauten, 1862 Meter hoch, 560 Kilometer vor der Küste Marokkos. Madeira ist 741 km² groß, 490 Hektar davon sind Wein, der Rest Blumen, Berg und Bananen. Die Erde ist furchtbar fruchtbar. Auf der Nordseite fällt die Insel mit brutaler Plötzlichkeit ins Meer, auf der Südseite senkt sie sich allmählich und fällt erst im Meer tausend Kilometer bergab. Im Süden verhält sich der Atlantik mittelmeermäßig, rivieraesque, im Norden knallen Tiefdruckgebiete mit voller Kraft auf die Insel. Dadurch hat Madeira zwei Gesichter. Eins ist nass und rau, das andere sonnig und warm. Jurassic Park und Hawaii. Die Wolken sind immer da, aber sie tun nichts und verfangen sich nur, wie eine gut gemeinte Drohung, das beständig schöne Wetter nicht zu vergessen. Menschen leben an Hängen. Alles ist hoch und tief, fällt bergab oder geht bergauf, selten geradeaus, man steht ständig am Hang, hat noch nie so viel Meer gesehen, sieht es von überall, immer wieder überwältigend, es ist von einem einzigartigen, tiefen, Blau. Die Insel wirbt um sich, mit ewigem Frühling, lädt Prominente ein, um den Imagewechsel vom atlantischen Altersheim zum dynamischen Inseleldorado zu vollbringen. Eigentlich muss man in Madeira mit dem Schiff eintreffen. Aber Kreuzfahrtschiffe will man nicht und soweit Segeln, kann nicht jeder. Fliegen ist daher nicht verkehrt. Piloten brauchen eine spezielle Lizenz, um hier landen zu dürfen. Wegen der Winde und der kurzen Landebahn, die zu einem wundervollen Dorfflughafen gehört. Nach dem Landen hat man fast schon ausgecheckt und nach dem Ausschecken sind alle Wege kurz. Der Flughafen ist klein und hat Meerblick, wobei alles auf Madeira Meerblick hat. Man kann draußen auf der Terrasse stehen und den Piloten mit ihren Lizenzen beim Landen zu sehen. Interessiert nach der Landung erst mal keinen, aber später, beim Abflug, wenn du auf der Terrasse stehst und an die Zeit zurückdenkst. Man lässt viel in diesem Ausblick zurück. Es ist nicht so wie anderen Städten, wo man am Flughafen noch nicht da ist. Alles ist sehr grün und sehr blau und sehr schön und das Schönste ist, dass es auf der Insel nichts Höchstes, Größtes und Erstes gibt, das hier schon angepriesen wird. Die Insel kommt fast ohne Attraktionen aus. Es gibt keine Eiffeltürme, Petersdome, Kolosseen, vor denen man anstehen kann. Keine bedeutenden Kunstsammlungen, Top Tens, Must-Sees, nur das Reids, Zimmernummer 501 […]