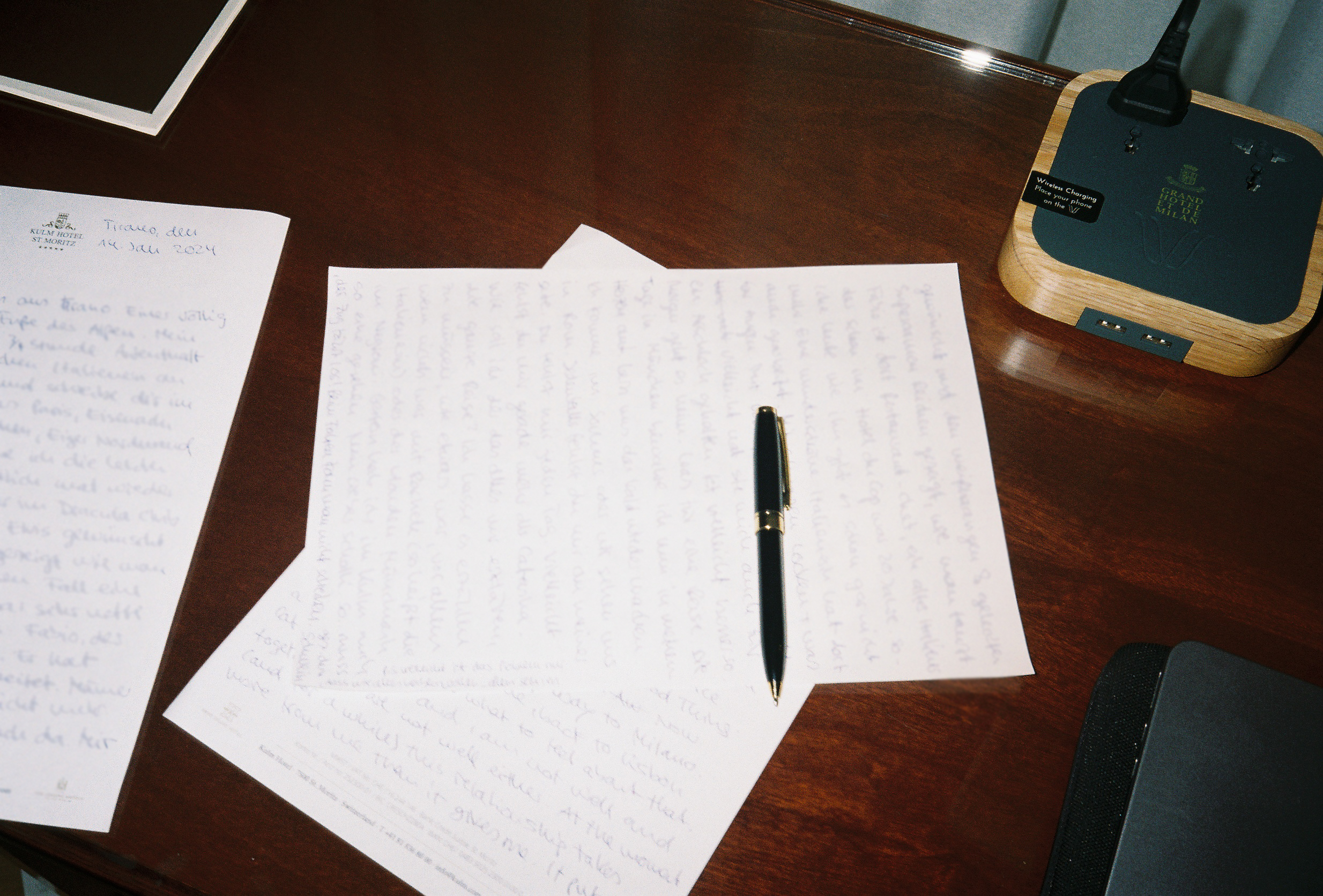ÜBER DEN FLUSS UND DIE WÄLDER II
Sie hatte Hoffnung. Ich hatte keine, ich hatte die aufgegeben und nahm nicht mal die Kamera mit. Wir fuhren vom Campingplatz ja nur zehn Minuten weiter, durch einen Tunnel, es musste ein Wunder her, aber als wir aus diesem Tunnel kamen, waren wir, wie soll ich sagen, im gleichen Land einer gan anderen Nation. Es war der Garten Eden. Das Grün hatte tausend Farben, die Zypressen beherrschten den Blick, links die Olivenbäume, rechts der Wein, in den Wäldern standen Trüffel und Pilze. Niemand, der zeltet. Wir fuhren von der Straße ab und dann eine, die gar keine war, mit unserem Auto aber gut ging. Wir fuhren, bis man nicht mehr Fahren konnte und dann liefen wir. Sie in einem schönen Sommerkleid, mit mittellangen Armen und einem Hut, den wir in Triest gekauft hatten. Es passt alles ganz wunderbar zur Landschaft. Ich? Es ist egal, was ich trug. Wir liefen oben am Meer lang, bis wir das Ende der Landzunge erreichten und sich eine schöne Bucht vor uns auftat, zu der ein paar Stufen aus Stein führten. Unten lag ein einsamer Strand aus Kies, ein paar Leute Schwammen, der Rest schlief. Wir schwammen und schliefen auch und hörten im Schlaf wie der Strand leer wurde und Leute über den Kies gingen. Ihre Stimmen drangen in unsere Träume. Als wir aufwachten war es schon spät, spät für Leute und Strand, für mich aber die richtige Zeit. Es war ja immer noch warm. Die Sonne kam gerade erst um die Ecke und strahlte flache über den Strand. Es ist besonderes am Abend am Strand zu sein, wenn er leer wird und sich die Erwartungen legen. Die Adria ist dann blau und still und salzig und ohne Wind. Wie Öl. Auf dem Rückweg aßen wir in einem kleinen, einfachen Lokal, auch auf Plastikstühlen, aber anders. Über uns hing der Wein, den wir tranken, Refosco nannten die den. Das Lokal wurde von einem netten schweigsamen Herren geführt, aber ich hatte nichts mehr gegen das Schweigen. Ich war in ihrer Gegenwart auch oft nur still. Keine Ahnung, was sie dann an mir fand. Als ich vorhin am Strand aufgewacht war und sie sah und sah, wie sie da lag am Strand, neben mir, und schlief in einem letzten Rest Sonne, mit der Adria davor und einem Buch von Triest daneben, in einem Kleid, dass sie von ihrer Mutter hatte, konnte man ja nur Schweigen. Man fragt sich, wieso man überhaupt je gezweifelt hat, wenn jetzt alles so ist und versteht, dass alle Tage und Nächte, auch die mit anderen, nötig waren. Ich dachte daran, wie wir eine Post gesucht hatten, um den Brief abzuschicken und sie anrief und mir gratulierte und ich nicht wusste, ob sie ihn bekommen hatte und still war, zum ersten mal und still war, als sie mich nochmal treffen wollte und ich ihr sagte, dass es jetzt nun vorbei sei und sie nochmal fragte, ob ich mir sicher wäre und ich sagte, ja. Natürlich möchte man der, die man lange geliebt hat, helfen, aber mit dem, was man tun müsste, würde man sich aufgeben. Wir haben stets die Möglichkeit. Das Leben hat nur ein Ziel und es ist meistens dieselbe Geschichten. Sie ist hart, rücksichtslos und schmerzt, aber solange sie schmerzt, weiß man, dass man lebt. Alles andere ist Existieren und tun, als ob es Veränderungen nicht gäbe. Es ist jene Arbeit, für die alle anderen Arbeiten nur Vorarbeiten sind und sie hatte mich in diesen Moment geführt und man bräuchte deshalb nie wieder Angst haben, vor dem was kommt oder nicht. Der nette, schweigsame Herr kam und stellte Teller hin. Wir aßen Tintenfische mit Tinte, Miesmuscheln mit Brot und Salat, nachts im Konvent sahen wir Fernsehen, wie alle hier. Gleich am Morgen beschlossen wir den Konvent zu verlassen. Beim auschecken meinte sie, sie hätte Anthony Hopkins einchecken gesehen, aber das war unmöglich. Wir verließen den Campingplatz ohne Groll, immer hin hatte der uns erst auf die Suche geschickt, und mieteten uns im Kempinski in Piran ein, um näher an unserer Bucht zu sein und im Kempinski. Das war ein gutes Hotel, mit Marijan, einem Concierge, den ich gar nicht mehr romantisieren brauchte. Er sagte, Piran wäre ein Ferienort an der slowenischen Adriaküste, bekannt für seinen langen Pier und seine venezianische Architektur und das im Freien Essen. Er nannte uns auf anhieb zwei geile Lokale, von denen sich unsere Welt aufspannte. Das eine war ein gutes, einfaches zum Essen, das andere ein gutes, einfaches zum Trinken danach. Ich habe selten einen Concierge erlebt, der so ins Schwarze trifft oder so ehrlich ist, denn die meisten werden von Restaurants bezahlt oder haben keine Ahnung vom Menschen verstehen. Nur einmal probierten wir ein anderes Lokal, auf einem schönen Platz, mit Brunnen und Fensterläden, von dem uns Marijan abriet, nur um zu sehen, dass er Recht hat, wenn er sagt, dass Muscheln mit Käse Verbrechen sind. Von hier an war der Wein nie weit und wir fuhren noch oft zu unserer Bucht bis man nicht mehr fahren konnte und liefen dann. Wir gingen die gleichen Wege und ich erzählte ihr Platons Geschichte von den Kugelmenschen oder die von der Welle und dem Felsen im Meer. Eines Abends war ein Paar am Strand, das stritt und ich war froh, nicht mehr das Paar zu sein. Wir fummelten an uns rum und schwammen. Sie war ganz toll im Wasser. Es schien ihr natürlicher Lebensraum zu sein, wie der jeder Portugiesin. Wir waren sorglos, wie die Kinder Napoli’s, neckten uns und schwammen voneinander weg, als wären wir 14 und an einer Bushalte. Aus irgendeinem Grund wollten wir uns nach dem Schwimmen immer mit Olivenöl einreiben. Auf dem Rückweg blühte und brummte dann alles, war ganz erschöpft vom Sommer und der Zeit, so wie wir und unsere Bucht lag lautlos und ruhig in der Ferne. Wenn sie nicht weiter laufen konnte, setzte sie sich einfach hin. Die Straße führte an einigen glücklichen Häusern vorbei, die Luft war warm, eine Umarmung der Welt. Alles glühte noch vom Tag und die Farben kehrten in ihre Dinge zurück. Die Bucht von Triest lag in der Ferne, wie Sterne über dunkelblauem Blau und ganz am Ende, so glaubte man, Miramare zu sehen. Ein Gedanke daran, wie alles begann und man fühlte sich wie die Landschaft ist […]