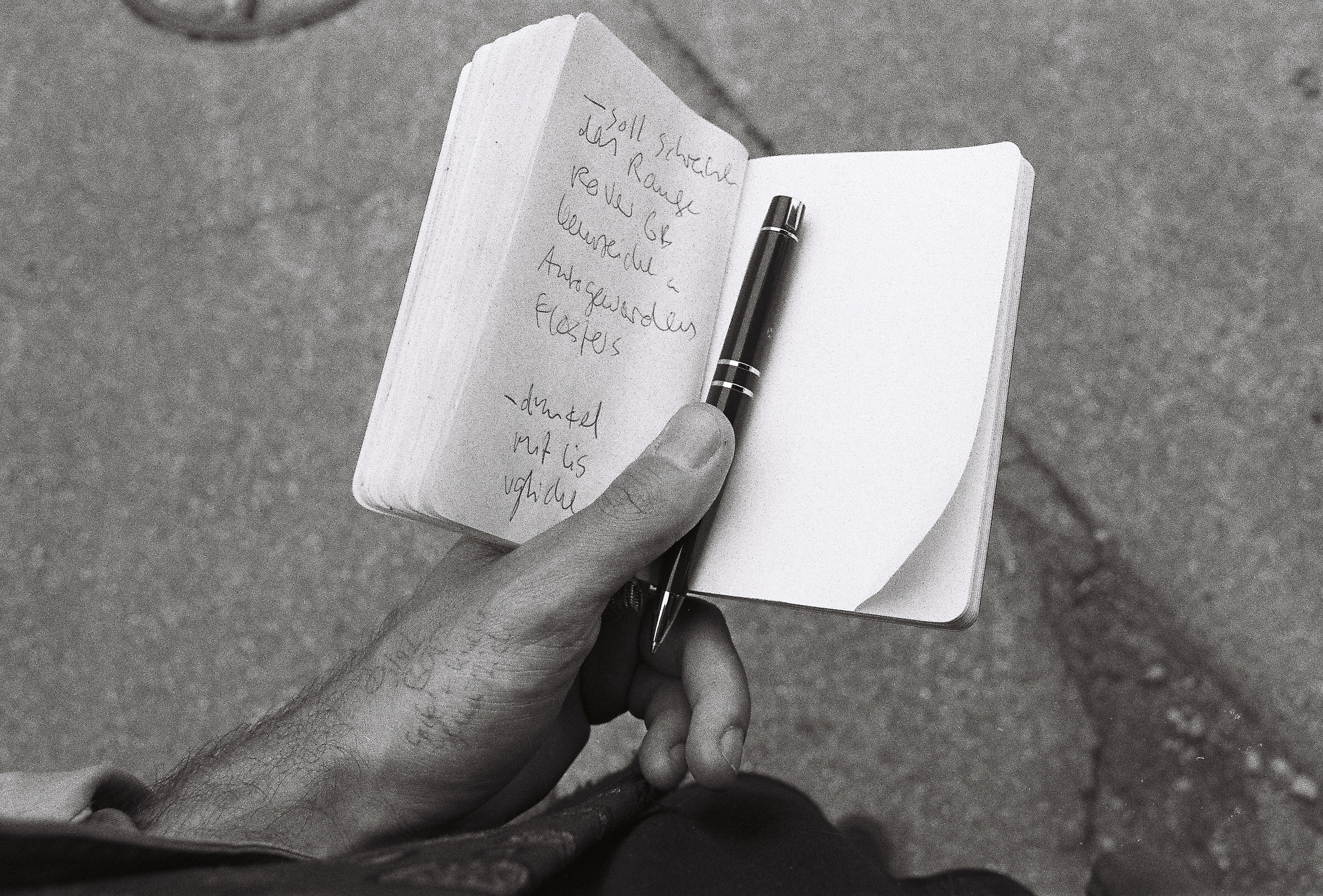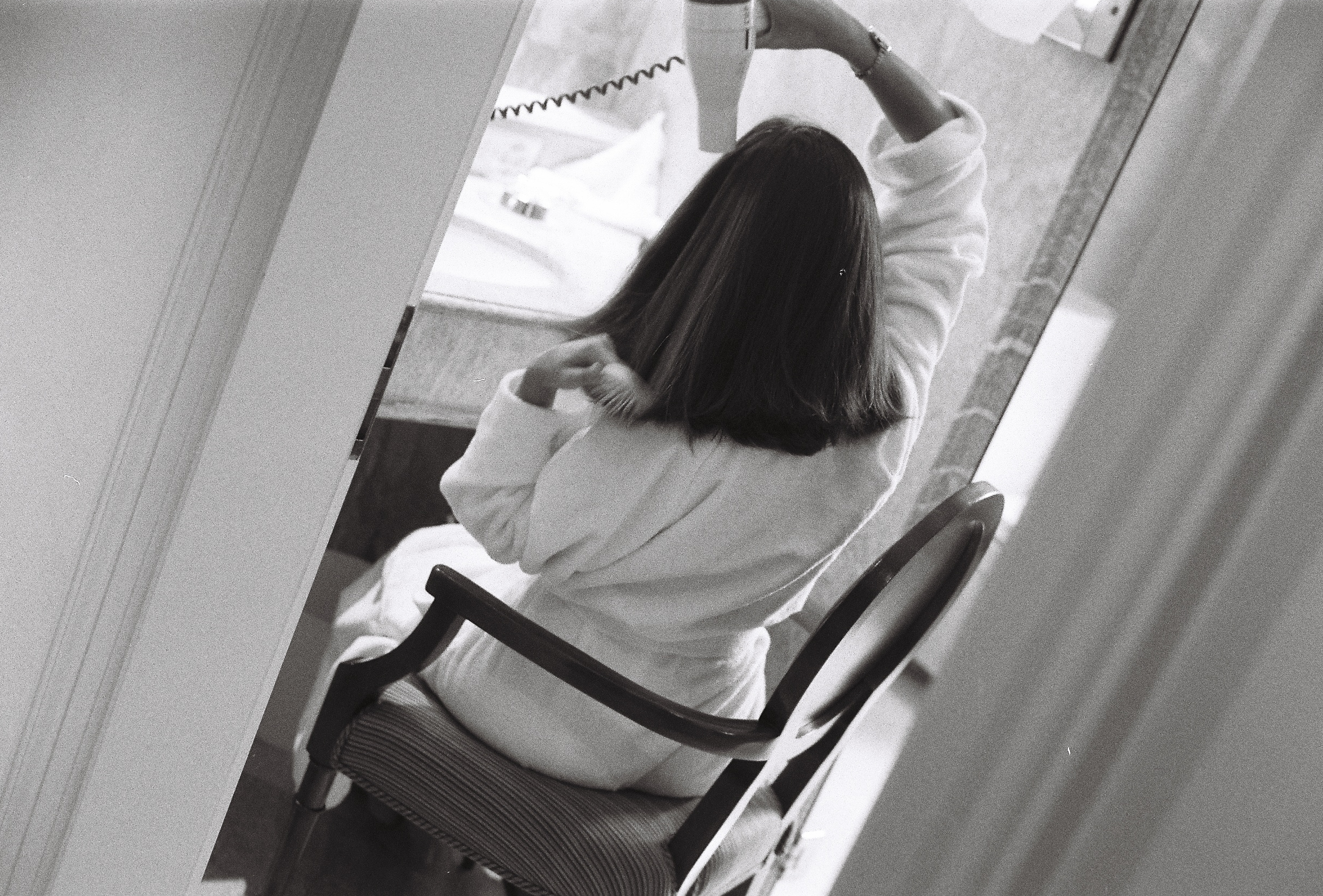EPIGONE II
Man fragt sich im Zug natürlich, ob das Sinn macht, für ein paar Negronis aus Klosters nach Mailand zu fahren, aber wenn man die Seen sieht, und die Inseln, auf denen wir mal Sommer verbrachten, denkt man das nicht mehr. Man sagt, die wären so tief, wie die Berge hoch sind. Gesehen hat das keiner, aber fühlen kann mans schon im Vorbeifahren. Sie sind ganz weich, neben steilstillem Fels. Abends ohne Angst, und morgens wie Meere einer ersten sonnigen Umarmung. Die Welt in Berge und Täler geteilt. Seit Menschen reisen sind sie von dieser Region begeistert. Altgediente römische Legionäre verbrachten hier ihren Lebensabend. Flaubert hielt die Inseln für den sinnlichsten Ort der Welt, sogar der Orient Express hielt damals in Stresa. Hier schafften Künstler, unter Palmen und voll Pasta, endlich einmal nichts zu schaffen. Remarque hatte irgendwo ein Haus, das mit allen Fenster zum See sah. Die Dörfer sind schön, die Gipfel weiß, und die Sehnsüchte der Menschen spiegeln sich in den Wellen wider, die manchmal blau und meistens grün sind. Man sagt, die Toten leben hier noch in den Wolken weiter und befruchten als Regen die Frauen und Stendhahl schrieb, wer zufällig ein Herz und ein Hemd besitzt, verkaufe es um am Lago Maggiore oder in Como zu leben. Wir fuhren durch Lugano und über über den Luganer See und kamen an seinem unteren Ende zum stehen. Man behielt uns für ein paar Stunden im Zug, bis man sagte, dass der nicht weiter gehe, wegen eines Unwetters wäre ein Baum auf die Gleisen geklatscht. Hunderte Menschen standen am Bahnhof, und wussten nicht weiter. Die Gesichter waren verzweifelt. Menschen mussten irgendwo hin. Ich nur Negronis trinken. Umso länger das hier dauert, desto besser wurden die. Ich setzte mich neben einen alten Mann mit Zigarre, Stil und Grandezza, der nicht sonderlich gestresst aussah und aussah, als würde er sich auch lieber mit Problemen rumschlagen, die es nicht gibt. Manchmal sagte der Mann irgendwas und fluchte, wenn denn ein Taxi kam und die Menschen wie wilde Tiere drum liefen. Ich sagte Si, Si. Er bot mir eine Zigarre an und so saßen wir da, tiefenentspannt, eine Weile, schweigend, in gleichfarbigen Anzügen mit Hut, zwischen all den schreienden Leuten. Rauchen ist tödlich, ich weiß, aber ohne das Rauchen wäre ich an diesem Tag nicht mehr nach Mailand gekommen. Denn nach der Zigarre sagte er, kommen sie, fahren sie mit mir. Ich fragte wie? Er sagte, sein Chauffeur wäre jeden Augenblick da. Er hätte nur darauf warten müssen, bis der von Mailand aus hier ist. Wir kamen am frühen Abend nach Mailand. Die Stadt war zerstört. Überall lagen Bäume rum auf Autos und Gleisen. Ich nahm mir ein Zimmer im Mandarin hinter der Scala, auch wenn das ein raumschiffmäßiges Hotel ist, und nicht mein Fall. Aber kein anderes ist so nah dran. Man musste nur noch aus der Tür, rechts an der Skala und links am Leonardo vorbei und die Galeria bis runter. Dann ist es da, gleich rechts, eine kleine Bar, vielleicht der beste Ort auf der Welt, um nach so einem Tag zu sitzen und in einer italienischen Zeitung zu blättern, deren Nachrichten man nicht versteht. Trotz des hektischen Treibens regiert ein Gleichgewicht, das von der Bar ausstrahlt, die seit 1915 gleichgeblieben ist. Getischlert von Eugenio Quarti, geschmiedet von Alessandro Mazzucotelli und gemalt von Angelo d’Andrea, hat sie nichts von ihrer Schönheit verloren, im Gegenteil, alle wirklich schönen Dinge werden schöner mit der Zeit. Die Scapigliatura Bewegung hat sich hier getroffen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was das ist. Es ist eine einfache, simple Bar, die um die Kurve geht. Im Hintergrund zeigt ein Spiegel auf den Platz zurück vor den Duomo und das Rot der Campariflaschen hinter weißen Kellnerwesten sorgt für den nötigen Sex. Zwischen dem 13. und 15. August 1943, genau 80 Jahre vor meinem Geburtstag, wurden die Galleria und das Camparino bei verheerenden Luftangriffen der Alliierten bombardiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Bar von Guglielmo Miani übernommen, einem Schneider aus Apulien, der 1922 nach Mailand gezogen war. Das Camparino ist ein Ort, an dem ein einfacher Aperitif, die Teilnahme an dieser Legende bedeuten kann […]